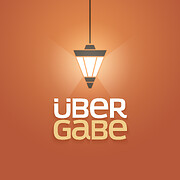Nina Warken als neue Bundesgesundheitsministerin
Die Ernennung von Nina Warken zur Bundesgesundheitsministerin wurde von vielen Beobachter:innen als überraschend wahrgenommen. Warken ist Juristin und war bislang im Bereich Innen- und Rechtspolitik tätig. Sie bringt keine ausgewiesene gesundheitspolitische Berufserfahrung mit. Im Zeitraum von 2015 bis 2023 war sie zudem Landesvorsitzende der THW-Landesvereinigung Baden-Württemberg und damit im Bevölkerungsschutz aktiv. Außerdem war sie Teil des parlamentarischen Begleitgremiums zur COVID-19-Pandemie.
Verschiedene Verbände ordnen die Personalie unterschiedlich ein. Der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) hebt hervor, dass es entscheidend sei, wie rasch der Dialog mit den Akteur:innen im Gesundheitswesen aufgenommen werde. Dabei wird insbesondere die Kommunikation mit pflegepolitischen Fachverbänden betont.
Zu den zentralen Themen im Gesundheitsministerium zählen die digitale Transformation – etwa durch die elektronische Patientenakte (ePA) – sowie Fragen der Finanzierung der Kranken- und Pflegeversicherung. Außerdem stehen Themen wie die Struktur des Rettungsdienstes genauso auf der Liste der notwendigen Aufgaben, wie die zukünftige Sicherstellung der (Haus)ärztlichen Versorgung, insbesondere im ländlichem Raum. Die Personalmangel in der Pflege ist weiterhin der größte Brennpunkt, da er direkt mit der Sicherstellung der Versorgung einhergeht. Laut Prognosen des Statistischen Bundesamts könnte bis 2049 ein zusätzlicher Bedarf von 280.000 bis 690.000 Pflegekräften entstehen. Allerdings wird von Unterstützer:innen ihre hohe Auffassungsgabe betont, mit der sie sich neuen Aufgaben schnell widmen könne.
Was ist von Nina Warken zu erwarten?
Warkens bisherige Aussagen deuten weniger auf einen Neuanfang oder einen wirklichen Strukturwandel hin. In einem Gespräch im Krankenhaus Tauberbischofsheim äußerte sich Nina Warken im Jahr 2021 zur Rolle einer Pflegekammer. Sie erklärte, dass sie eine Kammer für „ein grundsätzlich geeignetes Mittel“ halte, um Verbesserungen in der Aus-, Weiter- und Qualifizierung von Pflegefachpersonen zu erreichen. Allerdings zeigte sie sich weniger überzeugt von der Idee und betonte: „Wenn es der Wunsch der Pflegenden ist, den Schritt in diese Selbstverwaltung mit Pflichtmitgliedschaften und Pflichtbeiträgen zu gehen, unterstütze ich dies gerne.“
Nina Warken ist nicht nur politisch, sondern offenbar auch familiär mit der CDU verbunden. Ihr Schwiegervater Hans-Georg Warken war langjährig im Bundesvorstand der Jungen Union aktiv und ist Vorstand der einflussreichen Union Stiftung. Laut Recherchen von CORRECTIV unterhält die nach rechts gerichtete Stiftung Verbindungen zu Klimaleugnern sowie "Kräften aus dem Trump- und dem Orbán-Lager".
Als möglicher strategischer Unterstützer innerhalb des Ministeriums gilt Tino Sorge, CDU-Gesundheitsexperte und Staatssekretär. Seine Erfahrungen könnten helfen, die Einarbeitung in gesundheitspolitische Themen zu unterstützen. In der kommenden Legislaturperiode wird entscheidend sein, welche konkreten politischen Schritte umgesetzt werden.


Neue Pflegebevollmächtigte: Katrin Staffler übernimmt das Amt
Nach der Entscheidung, das Amt der Pflegebevollmächtigten doch weiterzuführen, wurde Katrin Staffler (CSU) zur neuen Amtsinhaberin ernannt. Staffler ist promovierte Biochemikerin, seit 2017 Mitglied des Bundestags und war bislang in den Themenfeldern Bildung und Forschung aktiv.
Ihre Ankündigung, sich mit „vollem Einsatz“ für die Belange von Pflegefachpersonen und pflegebedürftigen Menschen einzusetzen, wurde von Verbänden positiv aufgenommen. Der DBfK begrüßt den Erhalt des Amtes und sieht darin ein wichtiges politisches Signal. Gleichzeitig gibt es die Forderung, das Amt langfristig als „Chief Government Nurse“ im Kanzleramt zu verankern – vergleichbar mit Modellen in anderen Ländern wie Großbritannien oder Kanada.
Zentral wird sein, ob es gelingt, die Interessen der Pflege und der Pflegebedürftigen fachlich fundiert und politisch wirksam zu vertreten. Dabei steht auch der kontinuierliche Austausch mit der pflegerischen Praxis im Mittelpunkt.

GKV-Spitzenverband: Repräsentative Befragung zur Rolle der Pflege
Eine aktuelle Befragung des GKV-Spitzenverbands unter über 3.500 gesetzlich Versicherten zeigt eine hohe Akzeptanz gegenüber erweiterten Rollen von Pflegefachpersonen im Gesundheitssystem.
Wichtige Ergebnisse:
- In 25 % der befragten Fälle in Hausarztpraxen hatten Patient:innen ausschließlich Kontakt mit nicht-ärztlichem Personal, darunter Pflegefachpersonen und medizinische Fachangestellte.
- 44 % der Befragten bewerten es als sinnvoll, wenn Pflegefachpersonen ärztlich unterstützen.
- 45 % wünschen sich, dass Pflegefachpersonen bestimmte Aufgaben eigenverantwortlich übernehmen.
Die Zustimmung ist besonders hoch bei älteren Menschen, chronisch Erkrankten und in ländlichen Regionen – also dort, wo Versorgungsengpässe häufiger auftreten.
Der DBfK sieht in den Ergebnissen eine Bestätigung für erweiterte pflegerische Kompetenzen. Konzepte wie Community Health Nursing werden dabei zunehmend diskutiert. Sie beinhalten präventive, beratende und koordinierende Aufgaben, die Pflegefachpersonen eigenständig übernehmen können.
Zentral bleibt die Frage nach der rechtlichen Verankerung solcher Rollen sowie deren Integration in bestehende Versorgungs- und Abrechnungssysteme. Auch digitale Anwendungen wie die elektronische Patientenakte könnten zur besseren Einbindung der Pflege beitragen.


📰 Kurznachrichten
Pflegearbeit als Schwerarbeit: Neuer Regelungsvorschlag aus Österreich
In Österreich wird Pflegearbeit ab dem 1. Januar 2026 offiziell als Schwerarbeit anerkannt. Damit erhalten Pflegefachpersonen unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit, früher in Pension zu gehen – mit einem geringeren Rentenabschlag.
Konkret bedeutet das:
- Pflegefachpersonen mit 45 Versicherungsjahren und mindestens 10 Jahren dokumentierter Schwerarbeit in den letzten 20 Jahren können mit 60 Jahren in Pension gehen.
- Der Rentenabschlag beträgt dann 1,8 % pro Jahr statt der regulären 5,1 %.
Die Maßnahme wird als Anerkennung der körperlich und emotional belastenden Pflegearbeit verstanden. Gleichzeitig weisen Vertreter:innen wie Elisabeth Potzmann vom Österreichischen Gesundheits- und Krankenpflegeverband (ÖGKV) darauf hin, dass nur wenige Pflegende die Voraussetzungen erfüllen könnten.
Die frühzeitige Pensionierung könnte zudem die Versorgungskapazitäten beeinflussen, wenn keine kompensierenden Maßnahmen – etwa durch Ausbildung und Personalgewinnung – ergriffen werden. Für Deutschland bietet das Modell einen möglichen Impuls für die Debatte über die Anerkennung der Pflege als Schwerarbeit.

Werde Teil der Übergabe-Community